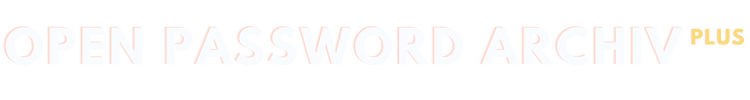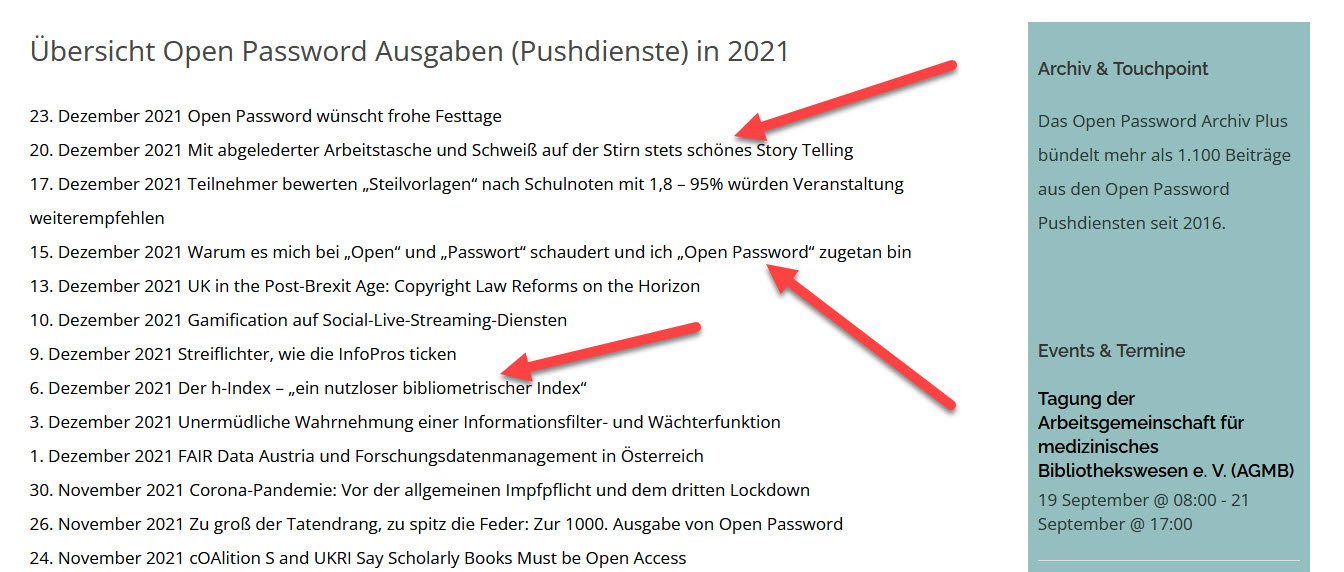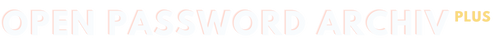Open Password – Dienstag, den 26. September 2017
#259
DGI-Forum Wittenberg – Elgin Helen Jakisch – Information Professionals – Matthias Ballod – Paul H. Grice – Ruth Elsholz – Internetkonzerne – Öffentlichkeitsarbeit – Datensouveränität – Automatisierung – TIB – Informationsbeschaffung – Publikationsverhalten – Sören Auer – Forschungsdaten – Beratung – Open Access – Nicht-textuelle Materialien
DGI-Forum Wittenberg
Am Anfang war das Wort.
Hat der Infoprofi heute das Sagen?
Impulse und Stimmen vom DGI-Forum Wittenberg
Von Elgin Helen Jakisch
Passend zum Reformationsjubiläum war Thema des diesjährigen DGI-Forums Wittenberg die Sprache selbst: „Am Anfang war das Wort – wer aber hat heute das Sagen? Sprache, Wahrheit und Datensouveränität in modernen Kommunikationswelten“. Ein gewohntes Terrain für Information Professionals. Dennoch hat man das Gefühl, dass andere Player das Sagen haben, wenn es um die automatisierte Informationsvermittlung in heutigen Zeiten geht. Bei der Abschlussdiskussion startete man also mit der Frage, wie und wo sich Information Professionals heute einbringen können. „Die Digitalisierung wird Arbeitsplätze kosten und deshalb muss man flexibel bleiben,“ so Matthias Ballod, Mitglied im Programmkomitee, Professor an der Martin-Luther-Universität und Moderator der Veranstaltung.
Damit umreißt er das Dilemma, indem sich die Branche gefühlt schon lange befindet. Gemeint ist die Frage, ob die technischen Lösungen am Ende auch den Menschen dahinter verschwinden lassen oder gar ablösen.
Hat der Infoprofi also heute das Sagen und vor allem die Deutungshoheit über die digitale Welt? Sicher nicht in allen Bereichen. Längst gelten die Internetkonzerne als die „Hüter des Wissens“ und nicht der Information Professional, der sich selbst als Gatekeeper wahrnimmt oder es mindestens sein möchte. Ein Teilnehmer meinte lakonisch: „Wir haben zwar den Tiefenspeicher erfunden, aber der User will den Google-Schlitz.“ Trotzdem: der Infoprofi hat den Kontext verstanden, indem er sich bewegt. „Das, was hinter Google kommt, ist der Schlüssel zur Informationskompetenz“, so Luzian Weisel, Vizepräsident der DGI und aktives Mitglied im Arbeitskreis Bildung und Informationskompetenz.
_______________________________________________________________________
Wissensmanagement, das Erlangen von Glaubwürdigkeit und das informationskompetente Handeln sind Kernaufgaben der Infoprofis.
________________________________________________________________________
Die Branche diversifiziert sich. Kann sein, dass man die Vereinzelung der „Informationsvermittler“ nicht wirklich wahrnimmt. Agiert doch jeder mehr oder weniger in seiner Filterblase. Die vielfach beschworene und derzeit verlorene Einheit der Profession wird sich vielleicht nur wiederfinden lassen, wenn man sich klarmacht, wie wichtig ein gegenseitiger Respekt, die Kommunikation und die Anerkennung über die Grenzen der Disziplinen hinweg notwendig geworden ist. Es ist gar nicht mehr möglich, überall auf dem Laufenden zu bleiben. Gerade hier leistete das DGI-Forum in den vergangenen Jahren einen wichtigen Beitrag, um interdisziplinäre Sichtweisen zusammenzuführen. „Am Ende haben wir doch alle das gleiche Interesse“, so eine Stimme aus dem Publikum, „die Informationsvermittlung, egal mit welchen Methoden. Bloß keine Grabenkämpfe mehr.“
Die rege Diskussion während der beiden Konferenztage offenbarte, dass das Hauptanliegen eine seriöse und verlässliche Wissensarbeit im professionellen Kontext bleibt. Vielleicht lassen sich die „Thesen“ der Wittenberger Konferenz so zusammenfassen: Wissensmanagement, das Erlangen von Glaubwürdigkeit und das Handeln in Informationskompetenz sind keine Worthülsen, sondern Verpflichtungen zur Qualitätssicherung und Kernaufgaben der Infoprofis, egal mit welchen Methoden sie diese Verpflichtung erfüllen. Immer mehr Daten stehen den potentiellen Kunden zur Verfügung. Immer mehr Unübersichtlichkeit lässt den Wunsch nach Strukturierung des Wissens wachsen. Immer mehr Technologien entstehen, deren Funktionsweisen auch an Kunden vermittelt werden müssen. Wer formuliert die Anforderungen also praxisgerecht?
________________________________________________________________________
Der Infoprofi als Kommunikator im öffentlichen Raum.
________________________________________________________________________
Der Infoprofi des 21. Jahrhunderts wird ein besseres Marketing betreiben müssen. Eine wichtige Erkenntnis auf der Konferenz war, dass besser und gezielter kommuniziert werden muss. Die Kunst besteht darin, dafür die richtige Sprache zu finden, die nicht zu banal, aber fundiert genug bleibt, sonst „wird man nicht ernst genommen“ und verharrt im unverständlichen Fachchinesisch oder IT-Sprech. Es kommt darauf an, den Kontext des Kunden zu verstehen und die vorhandenen Methoden in seine Sprache zu übersetzen, um dann die geeigneten Lösungen anzubieten, die der Kunde versteht. Auch für Studierende sollte das Marketing der eigenen Kompetenzen und das Denken in Projekten sowie die Pflege einer für Kunden verständlichen Sprache verstärkt in die Lehre einbezogen werden. Man kann es auch mit den Konversationsmaximen von Paul H. Grice halten: Sage nur, was informativ, wahr und wichtig ist, und tue dies klar und deutlich.
Der Infoprofi hat das Sagen, wenn er „die Ansage macht“. So formuliert es auch Dr. Ruth Elsholz in ihrem Blog als Nachlese zur Tagung. Zieht man heute eine Parallele zu Luther, der den damaligen Medienwandel für die Verbreitung seiner Thesen nutzte, so sollte die Kommunikation nicht auf die üblichen branchenspezifischen Zeitschriften und Mailinglisten beschränkt bleiben. Vielmehr müsse man „kreativer und aggressiver werden“ werden und mehr über Tageszeitungen, Rundfunk, Fernsehen und Social Media in die breite Öffentlichkeit kommunizieren. „Der Nutzen der Wissensarbeit“, so eine Teilnehmerin, „muss stärker in den Fokus“, dies mit praktischen Einsatzbeispielen für komplexe technische Methoden und ihre Anwendbarkeit. „Über den Tellerrand schauen und sehen, wo man Expertise monetär einbringen kann“, ergänzte ein anderer Teilnehmer und zeigte sich zuversichtlich, denn „die Industrie sehnt sich nach gut ausgebildeten Retriev’lern.“ Wohl macht dies Hoffnung. Allerdings gilt es noch viel zu lernen und auszuprobieren, um potentielle Kunden tatsächlich zu erreichen.
Fazit: Information Professionals sind mehr denn je als „Übersetzer“ des Informationsbedarfs in Methoden zur Erschließung desselben involviert. Hier könnte die Arbeit der Verbände und Vereine ansetzen, so die Idee eines Teilnehmers, und einen „Schlagwort-Baukasten“ für seine Mitglieder anbieten, der sowohl die Anliegen als auch die Kompetenzen der Infoprofis verdeutlicht, mit denen die Allgemeinheit „was anfangen“ kann.
Wie die Souveränität über die eigenen Daten in fremden Speichern zurückgewonnen werden kann, ist kaum Thema der öffentlichen Debatte. Ein Teilnehmer schlug vor: „Es braucht einen Ethikrat für den Umgang mit Informationen und Daten.“ Auch hier kann der Infoprofi Kämpfer pro Medienmündigkeit sein und für Aufklärung sorgt, indem er die Interessen aufdeckt, die die öffentliche Kommunikation teilweise lenken, ohne sich selbst zu offenbaren.
________________________________________________________________________
Vielfältige automatisierte Lösungen für Information Professionals.
________________________________________________________________________
Viele der auf der Tagung präsentierten Projekte zeigten, wie vielfältig mittlerweile die Bereiche sind, in denen automatisierte Lösungen Information Professionals bei der täglichen Wissensarbeit unterstützen. Hier die diskutierten Themen:
- · Terminologie und Sprache;
- · die Deutsche Digitale Bibliothek;
- · ein neuer Fachinformationsdienst für Buch-, Bibliotheks- und
Informationswissenschaft; - · Indexierung 2.0 mit Hilfe von Textmining;
- · Wissensmodelle aus Texten und halb-automatisierten Methoden zur Erschließung
von Inhalten; - · Journalisten und Blogger als Gatekeeper von Informationen;
- · die Nutzung von Robotern bei der Generierung von Textbeiträgen für die Presse;
- · die Vermittlung von Informationskompetenz in 15 Minuten;
- · die Beschäftigung mit Phänomenen wie sprechenden Suchmaschinen;
- · Umgang mit Fake News contra Fakten, auch in Wikipedia;
- maschinelles Lernen in der Sprachverarbeitung.
Folglich gilt: Es gibt noch viele Themen seit Luther, die uns heute mehr denn je umtreiben: Information und Glauben, Information und Marketing, Information und Selbstbestimmung…
Programm der Tagung: http://www.dgi-info.de
Blog von Dr. Ruth Elsholz: http://blogs.pwc.de/cis/
Die Vorträge der Referenten erscheinen in den nächsten IWPs, einen zusammenfassenden Beitrag gibt es in B.I.T.-Online, und auf Youtube sind demnächst die Filmsequenzen der mitgeschnittenen Vorträge abzurufen.
Elgin Helen Jakisch, U&B Interim-Services, Berlin, jakisch@ub-interim.de
TIB
Forschungsdaten werden Mainstream,
Open Access braucht Reputation
Die Technische Informationsbibliothek hat 1.400 Wissenschaftler zu ihrer Informationsbeschaffung und zu ihrem Publizieren befragt. Direktor Auer sieht sich in den folgenden Annahmen bestätigt: „Forschungsdaten sind inzwischen ein zentraler Teil des wissenschaftlichen Schaffens. Open Access kann zur erhöhten Sichtbarkeit beitragen, aber erfordert vergleichbare Reputation der Publikationsorgane. Neben klassischen Publikationen gewinnen andere Modalitäten wie Software, Wissensgraphen, 3D-Modelle, Videos und Daten zunehmend an Bedeutung.“ Ausführliche Zusammenfassung der Studie unter https://tib.eu/tibumfrageinformationsbeschaffungundpublikationsverhalten. Ein Teil der Forschungsdaten befindet sich unter: https://doi.org/10.22000/54.
„In einem Überblick über die Forschungsergebnisse führt die TIB aus:
Informationsbeschaffung und Recherche von Fachinformationen. Laut der TIB-Umfrage nutzen die Befragten zur Informationsbeschaffung am häufigsten traditionelle Wege wie wissenschaftliche Publikationen, gefolgt von persönlichen Kontakten mit anderen Fachleuten sowie Besuche von Fachveranstaltungen. Für die Recherche von Fachinformationen greifen sie mehrheitlich auf Google (81 Prozent), Wikipedia (68 Prozent) sowie Google Scholar (60 Prozent) zurück. Bibliothekportale werden von der Hälfte der Befragten regelmäßig zur Recherche genutzt, als Stärke sehen sie dort den direkten Zugriff auf Daten und Dokumente. Fachartikel, darunter auch Artikel aus Open-Access-Fachzeitschriften, sind bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die am häufigsten genutzte Publikationsform. Mit einem Anteil von 60 Prozent haben Bilder und Grafiken einen mittleren Anteil, gefolgt von Forschungsdaten (zum Beispiel Messdaten, Materialproben, Simulationsdaten oder Strukturformeln) und Nicht-Verlagspublikationen – sogenannte graue Literatur, zu der Veröffentlichungen wie Tagungs-, Kongress- und Forschungsberichte gehören, die nicht im Buchhandel erhältlich sind.
Entstehung wissenschaftlicher Beiträge und Materialien. In der Wissenschaft entstehen heute neben klassischen Publikationen zahlreiche zusätzliche Materialien. Das können Daten, Tabellen, elektronische Textdokumente, Grafiken, Filme oder Datenbanken sein. Die Befragten geben an, dass es sich bei den Materialien, die während ihrer Forschungstätigkeit entstehen, am häufigsten um Artikel in Zeitschriften, darunter auch Open-Access-Zeitschriften, handelt. 60 Prozent gaben an, dass ihre Materialien auch als Nicht-Verlagspublikationen (zum Beispiel Kongressberichte) veröffentlicht werden. Neben diesen textuellen Materialien produzieren 44 Prozent der Befragten im Forschungsprozess auch nicht-textuelle Materialien wie Bilder, Grafiken oder 3D-Modelle. Jeder Zehnte erstellt inzwischen auch audiovisuelles (AV) Material wie Aufzeichnungen von Experimenten.
Veröffentlichung wissenschaftlicher Beiträge und Materialien. Zwei Drittel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler veröffentlichen inzwischen in Open-Access-Zeitschriften, als Hauptgründe nennen sie die freie Zugänglichkeit, eine höhere Sichtbarkeit und Zitationswahrscheinlichkeit. Bei der Entstehung und Veröffentlichung nicht-textueller Materialien zeigt sich eine deutliche Diskrepanz: Zwar entstehen bei der Mehrheit der Forschenden nicht-textuelle Materialien, allerdings veröffentlicht nur ein geringer Teil diese Materialien auch. So veröffentlich nur 20 Prozent der Befragten ihre Forschungsdaten beziehungsweise wissenschaftliche Software. Im Forschungsprozess entstandenes AV-Material wird sogar nur von jedem Zehnten publiziert. 73 Prozent der Befragten veröffentlichen ihre Materialien mit einem Digital Object Identifier (DOI), der die nachhaltige Zitierung und Verlinkung digitaler Materialien im Internet ermöglicht. Bei den Publikationen mit DOI handelt es sich überwiegend um wissenschaftliche Artikel. Forschungsdaten, Bilder und Grafiken, graue Literatur, AV-Medien, 3D-Modelle oder Software erhalten dagegen weitaus seltener einen DOI. Mehr als der Hälfte der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerin wissen laut der TIB-Umfrage nicht, dass DOIs auch für andere digitale Publikationen vergeben werden können.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wünschen sich Unterstützung. Ein weiteres Ergebnis der Umfrage war, dass sich die Forschenden in verschiedenen Bereichen Unterstützung wünschen: So signalisierte fast jeder Dritte zu Open Access und zu Text-Repositorien Beratungsbedarf. 25 Prozent der Befragten würden Beratungsangebote zu Forschungsdaten nutzen, beispielsweise zum Publizieren und Zitieren der Daten. Im Bereich AV-Medien würden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei der Recherche, bei Fragen zur Zitierfähigkeit, zu Lizenzfragen und zur Publikation auf Beratungsnagebote zurückgreifen.“
Anzeige
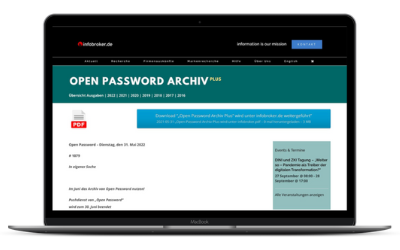
FAQ + Hilfe